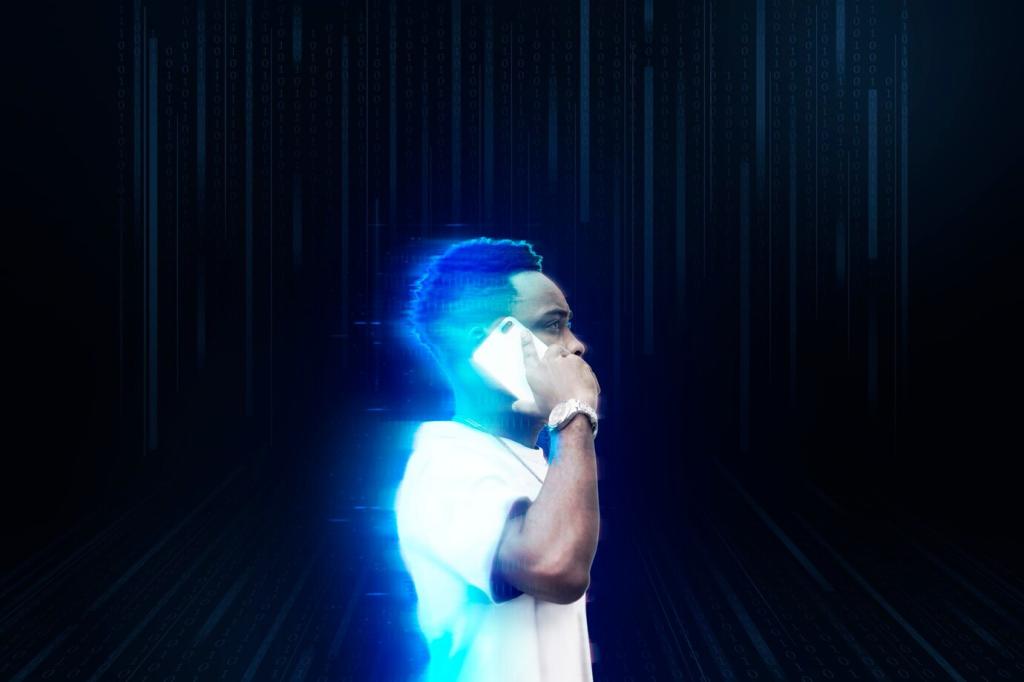Die Umweltauswirkungen der KI-Infrastruktur
Der rasante Fortschritt im Bereich der Künstlichen Intelligenz hat nicht nur die technologische und wirtschaftliche Landschaft tiefgreifend verändert, sondern bringt auch erhebliche ökologische Herausforderungen mit sich. Die notwendige Infrastruktur hinter KI-Anwendungen ist hochkomplex und ressourcenintensiv. Während die gesellschaftlichen Potenziale künstlicher Intelligenz oft im Mittelpunkt stehen, gerät der ökologische Fußabdruck der benötigten Rechenkapazitäten, Datenspeicher und Netzwerkstrukturen häufig in den Hintergrund. Die Umweltauswirkungen der KI-Infrastruktur verdienen jedoch eine kritische Betrachtung, da sie wesentliche Aspekte wie Energieverbrauch, Ressourcenbedarf, Treibhausgasemissionen und die Lebensdauer von Hardware beeinflussen.
Energieverbrauch von KI-Rechenzentren
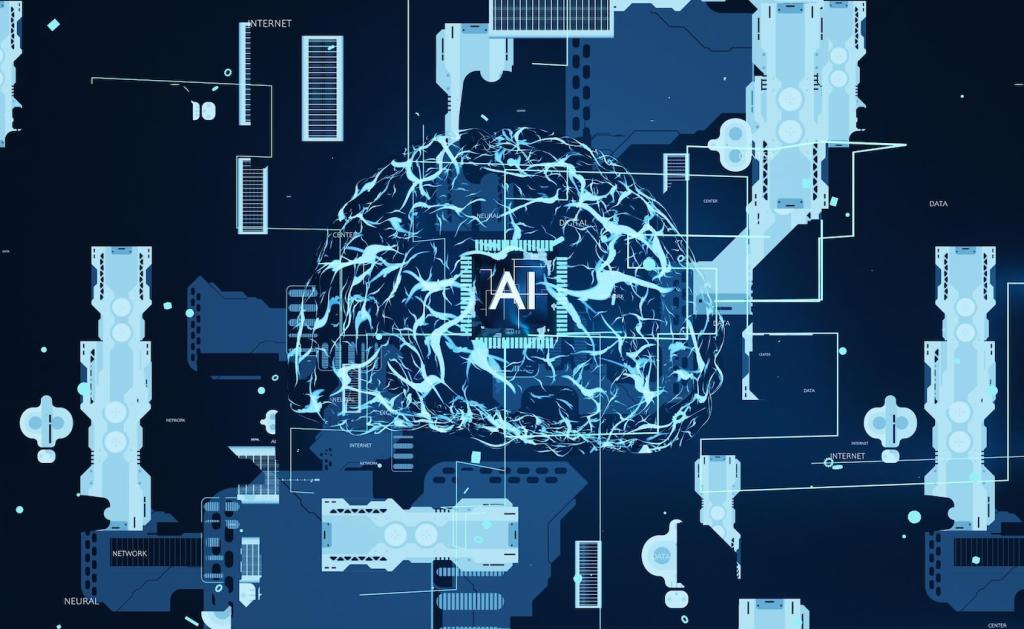
Ressourcenbedarf und Rohstoffnutzung
Seltene Erden und problematische Rohstoffe